Alfred Jodl, Generaloberst,
Tragödie des absoluten Gehorsams

Alfred Jodl - Hitlers militärischer Berater
Von Bodo Scheurig
Alfred Jodl - Generaloberst, Chef des Wehrmachtführungsstabes und 1946 in Nürnberg durch den Strang hingerichtet - verkörpert den Jammer oder die Tragödie des absoluten Gehorsams. Ursprünglich Opponent Hitlers und ein herausragender Generalstabsoffizier des Reichsheeres, verstrickten ihn später Amt und eine Gläubigkeit, die sich auch gegen klare militärische Erkenntnisse behauptete. Wenn er trotzdem - und zwar als einziger in Hitlers unmittelbarer Umgebung - einer Auseinandersetzung wert bleibt, so vor allem deshalb, weil er dem Diktator auch schroff, mit hochfahrender Schärfe widersprach und die Aufkündigung der Genfer Konvention zu verhindern wußte. Sein Charakterbild - geprägt durch tiefgreifende, unauflösbare Widersprüche - stellt namentlich den Historiker vor Rätsel.
Jodl war als Chef des Wehrmachtführungsstabes ersetzbar, vor allem durch vollkommen Unterwürfige, aber Hitler verweigerte seine vorgesehene Ablösung, nachdem der präsumtive Nachfolger Paulus in Stalingrad geblieben war. Hitler hielt Jodl, auch wenn er diesem Berater hartnäckig grollte, während der Kaukasus-Krise 1942 nicht zu ihm gehalten zu haben. Selbst Eisigkeit im Umgang schien dem Diktator willkommener, als neue, unbekannte Gesichter an seinen Kartentisch zu ziehen. Und instinktiv ging er, von sich aus, wohl die richtigen Wege. So kühl und gespannt seit der Kaukasus-Krise 1942 die meisten seiner Lagebesprechungen waren, die gewohnte Riege ertrug jede Schroffheit, alle Stiche. Trotz anhaltenden Grolls durfte er glauben, daß ihre Loyalität ungebrochen war. Von Torturen seiner Umgebung erfuhr er nichts. Einsprüche veranlaßten ihn, wenn überhaupt, nur zu belanglosen Abstrichen. Wie zuvor entschied und befahl sein Wille.
Jodl fügte sich, drang auf keine Ablösung; vorab aus mangelndem Antrieb, der seine Loyalität bezeugte. Der Preis war bitter, vielleicht auch Anlaß zu trüben Gedanken: das Kommando über eine Gebirgsjäger-Armee - Wunsch nicht nur des Herzens - blieb ihm verwehrt. Um so mehr vergrub er sich in die "Operative Führung", emsig bemüht, diesen Bereich gegen "fremde" Sachverhalte abzuschotten. Weniger denn je wollte er sein Arbeitsfeld ausweiten, sondern lediglich das militärische Tagewerk tun. Bewußt mied er, was "unnötig" verstörte. Fast schien es, als sähe er jenseits seiner gewiß randvollen Pflichten weg. Politik - Korrelat gerade der operativen Kriegführung - schob er von sich. Sie, meinte er, überschaute er nicht, war nie sein Feld. Mochte ihm Schärfe des Verstandes zeitweise sagen, daß er, in zu engen Fesseln, Selbsttäuschungen hegte: Politik sollte und würde Hoffnungen lassen. Schon aus Schutzgründen vertraute er dem Staatslenker Hitler, dessen höherer Einsicht oder besserem Wissen.
Es schien ihm unangemessen, Bedenken oder gar Kleinmut zu zeigen. Ein fester gläubiger Durchhaltewille stand für ihn über allem. Möglich, daß er die Ursachen des Zusammenbruchs von 1918 auch jetzt noch nicht richtig wertete. Im Willen, intakte Moral zu überschätzen, ja, ihr höchsten Eigenwert zuzumessen, blieb er HitIer allzu nahe. Schwankende Siegeszuversicht in Akten und Vorlagen verleitete ihn zu empörten, einschüchternden Randbemerkungen. Bis zuletzt nannte er Lauheit selbst bei höchsten Rängen behende Defaitismus. Warlimont (General Walter Warlimont, Stellvertretender Chef des Wehrmachtführungsstabes im OKW) hörte - bei einem Anlauf zu kritischer Aussprache - Drohungen mit dem Konzentrationslager.
Jodl wollte gewissenhafte, stets "funktionierende" Zuarbeiter, keine, die in Versuchung kamen, Skepsis hinsichtlich der Kriegslage auch nur anzudeuten. Was zu entscheiden und "ganz oben" zu sagen war, wünschte er selbst zu entscheiden und "ganz oben" zu sagen. Jede mögliche Kompetenz seines Bereiches hatte er Zug um Zug an sich gezogen, ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis oft urteilsfähiger Offiziere zu ihrem Chef gleichsam unterbunden. Der Wehrmachtführungsstab war und sollte Jodls eigenes Hilfsbüro sein, das strikt militärische Tagespflichten erfüllte. Der Stab schien je länger, desto mehr passend auf ihn zugeschnitten.
Die vermutlichen Nachteile seines Unwillens, andere als dienstliche Belange zu erörtern, bekümmerten ihn kaum oder ertrug er wohl in dem Glauben, zusätzlicher Erleuchtungen nicht bedürftig zu sein. Die Masse der Unterlagen auf seinem Schreibtisch, mochte er meinen, gewährte ihm hinreichend Überblick. Die Schlüsse seines Denkens, das nicht aufhörte, gingen niemand etwas an. Unwahrscheinlich, daß selbst rückhaltlose Aussprachen unter vier oder mehr Augen seine äußere Haltung geändert hätten. Er hatte im Hauptquartier nur einen Vertrauten: Walter Scherff, den Beauftragten für die Kriegsgeschichtsschreibung, als ergebener Hitler-Anhänger eher eine fragwürdige Adresse. Zu Scherff sprach er von Sorgen, auch über die schändliche Behandlung der gefangenen Rotarmisten, die sein ursprüngliches Ehrgefühl beleidigte. Sonst blieb es bei selbstverordneter, unüberbrückbarer Distanz. Noch weniger drängte ihn seine Schweigsamkeit zu Ansprachen vor dem Stab und anderen Gremien, am wenigsten zu Reden über die instinktiv gemiedene "Politik". Hatte er freilich zu sprechen, wählte er - nach nüchternen Analysen - martialische Schlußworte, die namentlich Sachkenner bestürzen, ja, zu abfälligen Urteilen verführen mußten. Bedenken oder gar Kleinmut sollten, durften sich nicht in des Führers "Gefolgschaft" regen.
Die Opfer des Krieges schmerzten ihn, er verstand Trauer und wußte einfühlend zu trösten, aber gerade im Familienkreis beharrte er bei Klagen auf Unbeugsamkeit, auch wenn er wie sonst den Verstand kaum zu überzeugen vermochte. Als ihn - etliche Monate nach Stalingrad - Luise von Benda fragte, ob nicht der Krieg zu beenden sei, um die Substanz des Reiches zu erhalten, wies er sie "fast mit Schärfe zurecht". Noch in einem Brief sprach er von der Notwendigkeit, durch dick und dünn zu verfechten, daß "wir diesen Krieg gewinnen". "Helden gibt es nur wenige, nur sie kämpfen bis zum Tode. . . Die Masse kämpft nur, solange sie an die Möglichkeit eines Erfolges glaubt. Sieht sie ihn nicht mehr, sucht sich jeder einen bequemen Ausweg, mit dem er dann seinen niedergebrochenen Willen oder seine Feigheit bemäntelt. Wer glaubt, daß man jetzt Frieden machen muß, der erfindet die Ausrede von der Erhaltung der Substanz und will damit nicht sehen, daß er überhaupt alles der Vernichtung preisgibt." Erst während des Nürnberger Prozesses schrieb er, daß diese Kontroverse nur deshalb aufgekommen sei, weil sie in ihm eine schon "wunde Stelle berührt" habe, "die niemand merken durfte". "Sorge um den Kriegsausgang" verbarg er, Mitte 1943, sogar gegenüber seiner Frau; ihren "Idealismus" wollte er zuallerletzt "zerstören".
Seine Fama im Heer war gefärbt durch die Reizworte "Oberkommando der Wehrmacht", in dem man - oft genug - eine frontfremde Befehlsorganisation erblickte und zu der er offensichtlich unablösbar gehörte. Er schien geschätzt bei Rommel, Model, Kesselring und Raeder. Niemand erlag der Versuchung, ihn mit Keitel gleichzusetzen. Selbst kritisch denkende Frontstäbe nannten ihn "operativ begabt, einen soliden Könner", aber zugleich und ebenso häufig "hitlerhörig", ja, "hitlerverfallen". Mehr als nur einmal erweckte er selbst solche Eindrücke.
1942, in der "Wolfsschanze", beantragte der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Generalfeldmarschall von Küchler, die Räumung des Demjansker Frontbalkons, um endlich wieder Reserven für seine Heeresgruppe zu gewinnen. Generalleutnant von Seydlitz-Kurzbach unterstützte ihn, indem er aus eigener Kenntnis die Geländeschwierigkeiten verdeutlichte, die weitere Angriffe zwischen Rshew und Ostaschkow insbesondere mit Panzern unmöglich machten, allein Hitler war - trotz mahnender Frontaufnahmen - nicht zu belehren. Beim Verlassen des Bunkers sagte Jodl zu Seydlitz: "Nach dem, was Sie soeben vorgetragen haben, kann ich Ihnen nur recht geben." Seydlitz erwiderte: "Wie ist es dann aber möglich, daß Sie dem Führer nichts gesagt haben?" Der Chef des Wehrmachtführungsstabes schwieg.
1943, bei einem Besuch in Roccosecca, auf dem Gefechtsstand des XIV. Panzer-Korps an der Nettuno-Front, bat ihn General von Senger und Etterlin, dringliche Ausweichbewegungen zu genehmigen. Wieder ging es, hier unter übermächtigem Feinddruck, um "Aussparung fehlender Reserven": für den Korpsstab eine Notwendigkeit, die "kaum noch zu erörtern" war, zumal die neue Stellung weite Geländeüberblicke bot. Jodl äußerte zu von Senger und Etterlin: "Herr General, Sie haben vollkommen recht, aber der Führer hat es anders befohlen." Derartige Vorfälle hoben schwerlich sein Ansehen, sondern schürten eher Groll, ja, Verachtung. Jeden, auch nur einen Verstoß gegen bessere Einsicht hatte die Truppe mit Blut zu bezahlen.
Um so erwähnenswerter das Urteil des Oberkommandierenden der Lappland-Armee, Eduard Dietl. Nach einem Auffrischungskursus der Universität Königsberg für Offiziere sprach er ungewöhnlich bissig von erlebter Feigheit unter Hochschullehrern. Einer der Professoren - ins Privatquartier Rovaniemi eingeladen - konterte freimütig, daß zur Zeit die Feigheit unter Offizieren weit auffälliger und vor allem viel gefährlicher sei. Er meine, ergänzte der Gelehrte, nicht Feigheit vor dem Feind. "Keine Rede. Aber Feigheit vor dem Führer. Privatim hört man von den Generälen, daß sie militärische Befehle des Führers für hellen Wahnsinn halten. Aber welcher General steht dazu und sagt dies dem Führer, offen heraus, in persona, dienstlich - statt nur hinter seinem Rücken?" Darauf Dietl, ohne Feindseligkeit, beinahe beschwörend: "Sie kennen wahrscheinlich den Führer nicht. Sie können nicht wissen, wie wahnsinnig schwierig es ist, ihm zu widersprechen, mit Erfolg ihm Widerstand zu leisten. Das könnten Sie von unserem Jodl erfahren. Es gibt zwei Jodl, den sogenannten großen und den sogenannten kleinen Jodl. Der kleine Jodl sitzt bei mir, der sogenannte große Jodl sitzt beim Führer. Ich kann Ihnen nur sagen: mein Jodl weiß, daß sein Bruder kein Feigling ist. Wie Sie es eben gemeint haben: der ist tapfer, Tag für Tag, aber ich sag Ihnen: es ist ein Martyrium. 'Sagt's ihm!' Das ist leicht gesagt. Es handelt sich um mehr als Tapferkeit. Stemmkraft, Klugheit, kann ich Ihnen sagen, unausgesetzte, unerhörte Stemmkraft."
Mehr denn je hatte 1945 der Siebenjährige Krieg - erinnern wir uns - als anspornende Parallele herzuhalten. Wie die NS-Propaganda redete Deutschlands Führer davon, daß Friedrich den Großen selbst Aussichtslosigkeit nicht entmutigt hatte, und wie der König mobilisierte er Willenskräfte, deren Fanatismus menschliche Gefühle verleugnete. Durfte man 1762 - konnte sicher auch Hitler fragen - noch für Preußen hoffen? Unbeugsamkeit verriet eher Herostratentum als aristokratisches Ethos. Doch diesmal half kein Tod einer Zarin, sondern war eine übermächtige Feindkoalition ohne Halbheiten zusammengeschmiedet. Diesmal zählten Arsenale und das Ziel der Gegner, einen Aggressor niederzuwerfen und schließlich auszutilgen. Der Fanatismus des Diktators, Rest einer eingebildeten "Mission", zielte ganz ins Leere.
Jodl neigte für sich nicht zu Verstiegenheiten, aber Produkt des Hauptquartiers, verfiel er - bewundernd - weiterhin Hitlers Willenskraft. Die Felonie seines Obersten Befehlshabers erschloß sich ihm selbst in der Endphase nicht. Plagten ihn je Zweifel, versperrte er sie rigoros: Im Diktator sah er Deutschlands legitimen Herrn, Deutschlands Schicksal. Seine nüchterne militärische Einsicht sagte ihm, daß operativ nichts mehr zu bestellen, geschweige denn zu wenden war. Eine Führung, die hätte führen können, hatte ausgespielt. Doch so bitter, ja, quälend diese Einsicht, kein Rückschlag tilgte gerade in ihm, was seit langem Strategien aufzuwiegen hatte: politische Wundergläubigkeit. Sie wurde wie zuvor zur Rechtfertigung, zur Sinngebung auch des vollends Sinnlosen.
Noch immer erhoffte er den Zerfall des feindlichen Bündnisses. Bei jedem Anzeichen, das auch nur eine Entzweiung andeutete, horchte er auf. Teilnehmer der Lagebesprechungen registrierten, wie sich hier seine sonstige "Maskenhaftigkeit" belebte. Dieser Hoffnungsfaden reichte bis zum Zusammentreffen der Gegner im Herzen Deutschlands, für ihn der Zeitpunkt, zu dem die widernatürliche alliierte Kriegskoalition spätestens zerbrechen mußte.
Jodls und anderer Hoffnung schürte namentlich Hitler, doch der Diktator selbst teilte sie schon vor der Ardennen-Offensive nicht, und offen hatte er inzwischen Illusionslosigkeit geäußert. Sogar die Nation konnte es dokumentarisch nachlesen. In seinem Aufruf an die Deutsche Wehrmacht vom 1. Januar 1945 hob er hervor, daß der unbarmherzige Kampf "um Sein oder Nichtsein" ginge. "Denn das Ziel der uns gegenüberstehenden jüdisch-internationalen Weltverschwörung ist die Ausrottung unseres Volkes." Heute, so weiter, könne "an der Absicht unserer Gegner niemand mehr zweifeln". Sie würde belegt durch Erklärungen der feindlichen Staatsmänner. Was also war - angesichts der eigenen militärischen Lage - noch zu erwarten, wenn nicht die sichere Katastrophe? Jodl hoffte, was er hoffen wollte: auch im Rückblick ein Faktor, der ihn salvieren könnte, aber die durchschaubare Wirklichkeit stempelte seine Haltung zu schierem Irrationalismus. Er hatte - nicht allein aus Kommuniqués - von der Teheraner und Jalta-Konferenz erfahren, Konferenzen, die eine ergrimmte Entschlossenheit bekundeten. Auf seinem Tisch lag "Eclipse", jener Plan, der Deutschlands Aufteilung in drei Zonen ankündigte und die russische Zonengrenze längs der Elbe verlaufen ließ. Konnte er, als Militär, ernstlich glauben, daß den Alliierten der Sieg zu entwinden sei - nun, da sie auf dem Sprung standen, mit erdrückender Übermacht ins Reich einzufallen? Es blieb kein Strohhalm, nur die Rettung aller noch Lebenden oder die Barbarei des letzten Gotenkampfes, die er - in Nürnberg - als "Unmöglichkeit für ein 80-Millionen-Volk" selbst verurteilte.
Der Gang des Krieges, Geschehen des Vordergrundes, gebar zudem eigene "Sinngebungen": Sie, schien es, brauchte sich Jodl nicht einmal einzureden. Er teilte die tiefe Furcht vor dem herandrängenden Bolschewismus und wußte: Wie der Frontsoldat wollte die Zivilbevölkerung im Osten nie in die Hände der Sowjets fallen. So unsinnig indes auch hier Hitlers Taktik, die imstande gewesen wäre, Deutschland durch die Westmächte besetzen zu lassen, Taktik, die freilich sein eigenes Ende beschleunigt hätte: Jodl deckte sie bis zu der Starrheit, die in West und Ost jede noch anwendbare Vernunft verhöhnte. Bei einem Erfolg der Ardennen-Offensive, hörte seine zweite Frau Anfang 1945, "hätten wir verhindern können, was sich jetzt in Ostpreußen abspielt".
Derartige Worte nahmen sich angesichts schon zurückliegender Tatsachen - noch gespenstischer aus. Hitler hatte seit langem aufgehört, Adressat eines Friedensschlusses zu sein. Bereits Anfang 1942 (!) äußerte er zu Jodl, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei. Nimmt man ihn beim Wort, hätte er unverzüglich abtreten müssen, um eine politische Lösung freizugeben. Die Wehrmacht konnte, Ziel der Blitzfeldzüge, das Nacheinander ihrer Gegner nicht wiederherstellen; sie stand vor einer ungeschlagenen, nie bezwingbaren Feindkoalition. Das Reich vermochte nur noch zu den besten Bedingungen Frieden zu schließen, Bedingungen, mit denen - so oder so - Hitlers Eroberungen ausgelöscht worden wären. Doch der Diktator weigerte sich, klarer Einsicht zu gehorchen und abzutreten. Staatsmännische Vernunft wich missionarischem Glauben, Politik einem Fanatismus, der selbst die Barbarei des letzten Gotenkampfes erzwingen wollte. Was immer zuletzt Hitler glaubte oder glauben machte, blieb durch sein Bekenntnis von 1942 widerlegt, entwertet.
Die Wehrmachtführung vernahm, daß der Krieg zu liquidieren sei, wenn der Kaukasus, das Donezbecken, die rumänischen Ölfelder und Oberschlesien verlorengingen. Sie setzte auf Ermattungsstrategie im Osten und Westen, die freilich ebenso rasch politisches Handeln verlangte. Begriff sie auch nur ihr eigenes Handwerk, mußte sie den baldigen Abbruch des Krieges ertrotzen. Nichts rechtfertigte sonst weitere Blutopfer an den Fronten. Aber der Diktator verhöhnte, bis zum Kampf um die Reichskanzlei, all seine Kriterien: so, als ob er nie von ihnen gesprochen hätte. Seine Verteidigung jeden Meter Bodens - Strategie der entschlossenen Dummheit - tilgte den Rest der Trümpfe, die Deutschland militärisch nicht verspielen durfte. Der Zusammenbruch - Tragödie des Reiches - nahte mit Riesenschritten. Nach Stauffenbergs Attentat blieb unter dem Diktator: dahinsiechendes Operieren, Schwärze, das Nichts.
Mochte die Wehrmachtführung in der Agonie Gründe finden, um weiterhin auszuharren und Pflichten zu tun: Hitler erniedrigte die Spitzengeneralität zu Robotern. Kampf ohne Glück wurde zum Ausweis der Unfähigkeit und Charakterschwäche. Mehr noch als die Zivilisten hatten die Soldaten des Widerstandes Mühe, den totalen Verrat gültiger Maximen und Ordnungen vorauszusetzen. Was Erziehung, Denk- und Entschlußkraft geboten, mußte um der Nation willen geschehen. Wenn nach 1945 entsetzt, ja, fassungslos auch die Wehrmachtführung gegeißelt wurde, so ist solchen Anwürfen mehr denn je recht zu geben.
Der Bruch erprobter Gesetze raubte dem Frontsoldaten Sicherheit und Geborgenheit. Schutzlos war er sinnlosen Befehlen ausgesetzt, die ihn wie sein Wesen zerrieben und auf die er - 1944/45 - mit Kampf bis zum vorletzten Augenblick zu antworten begann. Das Regime, purer Selbstmagie erlegen, wütete ungehemmt. Es hängte und erschoß schon Laue oder Zögernde; Mannschaften richteten schließlich Offiziere. Terror forderte jenen "Heroismus", den auch sieglose Zukunft nicht schreckte. Der Ausgang ließ die Nation verwüstet und ein Volk zurück, das am Soldatentum zweifeln mußte.
Als Hitler am 22. April 1945 den Krieg selbst für verloren hielt, schien endlich die fürchterlichste Sperre gegen jede Vernunft zu fallen. Der Besessene gab freie Hand, das massenmörderische Ringen einzustellen, aber gleich Keitel richtete Jodl den Diktator nochmals auf. Die Szene - oft bezeugt - blieb die schlimmste innerhalb der Geschichte des deutschen Offizierkorps. Viele, die hätten überleben können, waren zu weiteren Opfern bestimmt. Keitel eilte zu Wenck, dem Oberbefehlshaber der 12. Armee, um ihn zum Angriff nach Osten anzutreiben. Gemeinsam mit der Armee General Busses, die sich von der Oder absetzte, sollte er Berlin entsetzen und den Führer befreien. Ähnlich Jodls Auftrag für den Norden. Schroff verlangte er von Generaloberst Heinrici, daß dessen Heeresgruppe Weichsel, statt nach Mecklenburg auszuweichen, mit allen verfügbaren Kräften die Reichshauptstadt anzugreifen habe. Heinrici zweifelte an der Zurechnungsfähigkeit Jodls.
Die Debatten der beiden Generalobersten verstiegen sich bis zur Verletzung jeder Form, für Heinrici das "unerträglichste Ereignis" seiner Offizierslaufbahn. Die Rote Armee - hier wie dort übermächtig und nicht mehr zu bremsen - machte den Streit gegenstandslos.
War es Jodls Ziel, die alliierten Fronten in Deutschland aufeinander zurücken zu lassen und Hunderttausende vor dem Bolschewismus zu retten: keine abwegigere Strategie hätte er verfechten können. Dieses Ziel - noch sinnvoll, wenn von Sinn überhaupt die Rede sein durfte - verlangte den flüssigen Rückzug und mit ihm den rechtzeitigen Abschub der Zivilbevölkerung. Nichts hinderte die Wehrmachtführung, das Gebotene, ohne ideologische Scheuklappen organisiert zu tun. Unsinnige, weil aussichtslose Offensivunternehmen verhöhnten, was noch als einleuchtendes Konzept taugen konnte. Wie die Ardennenoffensive bürgte ein Angriff auf Berlin dafür, daß die alliierten Fronten nicht aufeinander zurückten und die Rote Armee erst recht Deutschland überschwemmte: Einsichten, die bereits damals nüchtern Denkende beherrschten, von den Männern des Widerstandes zuvor ganz zu schweigen. Jodls Haltung könnte - allenfalls - krankhaft gewordene Loyalität gegenüber Hitler erklären, Loyalität gegenüber einem schon erloschenen Diktator, der selbst aufgegeben hatte. Mit Kriterien militärischer Führung ist sie nicht zu messen. Sie half nur, die Katastrophe ins Abnorme zu steigern.
In Reims unterzeichnete er, eine Woche nach Hitlers Selbstmord, die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte. Jetzt mühte er sich, eigene Fehler ungeschehen zu machen, doch Eisenhower gestand - unwillig, ja, gereizt - lediglich einen Aufschub von 48 Stunden zu. Dönitz gab sein Einverständnis, in diese Galgenfrist für die Armeen und Zivilisten im Osten einzuwilligen. Tausende konnten den Sowjets noch entkommen. Der Großadmiral, laut Testament neues Staatsoberhaupt, berief Männer seines Vertrauens, Fachleute ohne allzu verstörende braune Färbung; die Kommandoverhältnisse in Flensburg, der letzten Enklave, wurden gestrafft, konzentriert. Hitlers Nachfolger löschte dessen "divide et impera". Wehrmachtführungsstab und Generalstab hörten auf, gegeneinander zu bestehen: überfälliges und nun gespenstisches Ende einer Jammergeschichte, die auch beste Führungsspitzen elendig gemacht hätte.
Jodl übernahm - nach dem Abtransport Keitels - die Geschäfte des OKW. Lagebesprechungen vermittelten seine Richtlinien oder das, was der Stab denken sollte. Er wünschte, in allem Dönitz "als Obersten Befehlshaber der Wehrmacht und nicht als Staatsoberhaupt herauszustellen". Wichtige Absprachen mit den Alliierten wollte er den "interessierten Stellen zur Kenntnis gebracht" wissen, "um Unstimmigkeiten zu unterbinden". Haltung und Auftritte, so seine strikteste Weisung, hatten sich an der gegebenen Zwangslage zu orientieren, mehr aber noch den soldatischen Ehrenkodex zu bekräftigen: Bei unwürdigen Handlungen der Delegationen Eisenhowers und Montgomerys war sofort zu protestieren. Überzeugt insbesondere von der amerikanischen Ahnungslosigkeit gegenüber deutschen Problemen, forderte er eigene Eingaben und Vorschläge zu den "großen Organisationsfragen", schon damit sich an ihnen die Sieger ihre Zähne ausbissen. "Wir haben bedingungslos kapituliert, da wir den Krieg bis zur letzten Phase und Konsequenz geführt haben, wo uns nichts anderes übrig blieb. Reminiszenzen an 1918 haben zu unterbleiben. Aus eigener Kraft können wir uns nicht helfen, nur mit Hilfe von anderen; d. h. das Schwergewicht unseres Handelns muß auf dem politischen Sektor liegen. Die Rolle Deutschlands als Volk inmitten Europas ist noch nicht ausgespielt. Ohne uns können die Probleme nicht gelöst werden. Dieses ferne Ziel immer im Auge behalten."
Er selbst fühlte sich berufen, alle Aufgaben zu meistern - Reflex offenbar des verschwundenen Drucks, der ihn jahrelang gequält, gegängelt hatte, doch wie seit je erwartete er festen Zusammenhalt, besonders unter seinen Offizieren. Jeden, der sich nicht als anständig und treu erwies, ja, Befehlen auch nur unbewußt zuwiderhandelte, wollte er einem englischen Gefangenenlager übergeben. Und hier folgte am 13. Mai 1945 - jenes fürchterliche Bekenntnis, mit dem er sich gleichsam selbst richtete, das die Tragik nicht der obersten Führung, sondern die des einfachen hingeopferten Mannes widerspiegelte: "Ich habe fünf Jahre geschwiegen und nur gehorcht und nichts für mich beansprucht, sondern nur gearbeitet. Ich bin gehorsamer Soldat gewesen und habe darin meine Ehre erblickt, den Gehorsam, den ich gelobt habe, zu halten. Ich habe in diesen fünf Jahren gearbeitet und geschwiegen, obwohl ich manchmal völlig anderer Meinung war und mir der Unsinn, der befohlen wurde, oft unmöglich erschien." Einwände aus Betroffenheit wurden nicht vernehmbar. Empörung hätte er auch und gerade jetzt hochfahrend zurückgewiesen. Die Stunde sprach für anerzogene Disziplin und nun, da nicht mehr der Diktator schaltete, sogar für Disziplin ohne innere Vorbehalte. Man muß nachlesen, was Jodl unvermittelt entfuhr.
Doch noch während seines letzten Jahres - 1946 - lag hinsichtlich des persönlichen Lebens "alles klar, sauber und folgerichtig" vor Jodl. Daß er auch ohne die Schuldvorwürfe des Nürnberger Gerichtsstatus versagt haben könnte, ließ sein Gehorsams- und Treuebegriff nicht zu. Dafür "kreiselte der Kompaß seiner Gefühle" bei Gedanken über den Mann, an dessen Seite er "lange Jahre ein so dornen- und entsagungsvolles Dasein" führte. Er leugnete nicht, daß sich dessen "Bild, in dem man einmal ein Kunstwerk zu sehen hoffte", nun in "teuflischer Entartung" zeigte, erdrückende Beweise sprachen unwiderleglich und beredt, aber hatte er, als Nur-Militär im Führerhauptquartier, je diesen ganzen Hitler gekannt und erlebt? Noch immer fühlte er sich außerstande zu sagen, was der Diktator wirklich "gedacht, gewollt und gewußt" hatte, allenfalls was er selbst "darüber dachte und vermutete". Gerade jetzt schien ihm, als habe Hitler - offenbar bestrebt, stets zu täuschen - auch seinen "Idealismus" mißbraucht, benützt zu verborgen gehaltenen Zwecken. War der Diktator teuflisch entartet von Anfang an oder erst später, "parallel mit den Geschehnissen", so vielleicht für künftige Historiker, nicht in Jodls eigener Geschichte. "Manchmal", schrieb er jedoch, "falle ich wieder in den Fehler, der Herkunft die Schuld zu geben, um mich dann wieder daran zu erinnern, wieviel Bauernsöhnen die Geschichte den Namen 'der Große' gegeben hat. Das ethische Fundament, das ist das Entscheidende, nicht der Wille und nicht der Geist."
So vernichtend solch ein Werturteil - auch für ihn, da es schon frühere Erkenntnisse widerspiegelte: Nichts vermochte seine Einschätzung der jüngsten Geschichte wesentlich zu ändern. Wie zuvor hielt er daran fest, daß es in Deutschland 1918 "viele und gute Ansätze zu einer ganz anderen Entwicklung" gab. Loyal, durfte er sich sagen, wäre gerade er ihr gefolgt, hätte sie sich überzeugend und segensreich entfalten können. "Zunichte gemacht" hatte sie der Versailler Vertrag, dem er uneingeschränkt die Hauptschuld beimaß. "Wenn das deutsche Volk nach einem fast zehnjährigen auf- und abwogenden Welt- und Meinungskampf zuletzt doch Adolf Hitler als seinen Führer erwählte, so letzten Endes, weil es keinen anderen Ausweg sah, aber doch mit jenem zweifelnden Vorbehalt und jenem instinktiven Urwissen, daß glänzende Meteore meistens ein Zeichen kommenden Unheils sind." Er selbst hatte, als Offizier der Reichswehr, keinen Anteil an dieser Wahl, nur am Gespür für kommendes Unheil, das er zumindest 1933 zeigte. Die Gründe seines inneren Wandels, die ihn zum Bewunderer Hitlers machten, verhehlte und widerrief er nicht, am wenigsten in Niederschriften ohne Blick auf seine Ankläger im Nürnberger Prozeß. Vielleicht bereute er jetzt - angesichts bestürzender Dokumente - manchen Satz im privaten Tagebuch. Überschwenglichkeit und flammende Worte muteten nun verstiegen an. Aber daß er 1939 den Krieg gewollt habe oder gar für ihn verantwortlich sei, empfand er als infamsten Vorwurf, den er zu Recht weiter bestritt.
Im Krieg selbst erblickte er rückschauend eine Folge von Operationen, in die ihn höhere, Hitlers Entschlüsse, hineingezogen hatten. Was vorab zu tun war, diktierte der Zwang heraufbeschworener Lagen - Lagen mit eigener Logik. Er hätte, bei seiner "unglücklichen Liebe zu den Franzosen", gern den Westfeldzug vermieden, möglicherweise sogar den siegreichen, wenn hier nicht "Zwang von Englands Erbitterung und Unbeugsamkeit" ausgegangen wäre, doch kein Schatten trübte seine Überzeugung, daß der Kampf gegen die Sowjetunion sinnvoll gewesen sei. Wann immer Hitlers Aggression verbrecherisch oder nur mutwillig genannt wurde, zog er das "Argument" des bedrohlichen russischen Aufmarsches im Frühjahr 1941 heran, der die deutsche Führung zum Praevenire genötigt habe. Gegen den wahren, fürchterlichen Charakter dieses Krieges sperrte er sich: einsichtslos, eisig. Bolschewismus blieb ihm wesenhafter Feind, Adolf Hitler nicht dessen Ableger, sondern Verteidiger des Abendlandes. Auch noch aus der Gefängniszelle sah er "Deutschlands Kampf - in seiner idealisierten, historischen Linie - genau so an wie einst den Kampf des Prinzen Louis Ferdinand mit seiner Vorhut bei Saalfeld. Er fiel und seine Truppen wurden geschlagen, aber wie damals: die Hauptkämpfe stehen erst bevor, und ob sie ein Jena und Auerstedt werden oder eine Völkerschlacht von Leipzig - für diejenigen nämlich, die humanistische Kultur zu verteidigen haben -, das liegt unwägbar im Schoße der Zukunft begraben".
Abebbende Prozeßarbeit gab ihm die Zeit zu einer längeren strategischen Studie, ihr Titel: "Ein Krieg zwischen den Westmächten und der Sowjetunion." Er schrieb sie nicht, weil er diesen, Deutschland "endgültig zerstörenden" Krieg ersehnte. Er fürchtete ihn als kommendes Duell zwischen zwei Systemen, erbitterten, unversöhnlichen Todfeinden - spätestens für den Augenblick, in dem Moskau Siegeschancen zu sehen glaubte. Er war sich sicher, daß, wenn den Armeen Sowjetrußlands befohlen würde, "den Vormarsch nach Westen zwischen Ostsee und Alpen anzutreten, sie es mit einer dreifachen oder noch größeren Überlegenheit zu Lande tun werden. Mindestens 25 000 hochwertige Panzerkampfwagen und ein fanatischer, siegeszuversichtlicher Kampfwille wird (sic!) die Stoßkraft dieser Überzahl von Divisionen noch beträchtlich erhöhen". Ihnen ist, so seine Überzeugung, durch die Westmächte nichts annähernd Gleichwertiges gegenüberzustellen. Wenn Rußland einstweilen zögere, so allein wegen der erdrückenden angelsächsischen Luft-Vorherrschaft und der amerikanischen Atombombe. Diese Lage freilich werde sich von Jahr zu Jahr - und zwar für alle drei Wehrmachtteile - zugunsten der Sowjetunion ändern. "Rußland wird alle Anstrengungen machen, seine Unterlegenheit zur Luft zu beseitigen. Es wird deutsche Flieger und Ingenieure dazu heranziehen und nicht ruhen und rasten, bis es das Geheimnis der Atombombe gelöst oder sich sonst verschafft hat." Rüstungswettläufe blieben vorgezeichnet.
Jodl rätselte nicht über Rußlands "wahrscheinliche" Kriegsoperationen. Er sah - längs der Demarkationslinie - die Rote Armee mobilisiert in drei Heeresgruppen: ohne Reserven wenigstens fünf Millionen Mann; die Hauptmacht bei der Mittelfront, zunächst zum schnellen Stoß vom Thüringer Wald auf Mainz bestimmt. "In der Tiefe gestaffelt, werden starke Kräfte hinter diesem vordersten Stoßkeil folgen, um dann, nach Norden und Süden eindrehend, den englischen und amerikanischen Divisionen den Rückzug nach dem Rhein zu verlegen. Die Nordfront wird die Nordseehäfen in Besitz nehmen, im übrigen aber mit ihrer Masse über Münster auf das Ruhrgebiet angesetzt werden. Die Südfront hat in Bayern und Württemberg größere Geländeschwierigkeiten und den weitesten Raum zu überwinden. Sie kommt daher in eine starke Rückwärtsstaffelung zur Mittelfront, was aber gerade dazu verhelfen kann, einen zu zäh vor dieser Front kämpfenden Gegner von Norden her im Rücken zu fassen und zu vernichten." Rettung bot für Jodl allenfalls sofortiger Rückzug hinter den Rhein, doch auch dieser Rückzug nur dann, wenn schließlich 130 bis 150 Divisionen das Westufer des Stroms verteidigten. Er warnte Engländer wie Amerikaner vor der Illusion, inmitten Deutschlands eine Entscheidungsschlacht schlagen zu können. Sie ende, lange bevor Luftwaffeneinsätze wirksam würden, "mit der Vernichtung der englischen und amerikanischen Besatzungsdivisionen östlich des Rheins". Die Rote Armee sei durch Landoperationen nicht mehr zu besiegen.
Einzig die angelsächsische Luftwaffe konnte, in seinen Augen, "vielleicht" die Versorgungsstränge und Kräftequellen des Feindes zerstören und so Rußland zwingen, den Kampf aufzugeben. Dazu bedurfte es indes nicht nur aller Fernbomber, die zuletzt gegen Deutschland und Japan eingesetzt waren, sondern ebenso vorgeschobener und insbesondere gut abgedeckter Basen, um die lebenswichtigen Schlüsselpunkte der UdSSR zu erreichen. Hier dachte der Autor an Schweden und die Türkei, für die Demokratien gewiß "das schwerste" politisch-militärische Problem, schon weil es - neben diplomatischer Kunst - höchstmögliche Stärke auch bei den westalliierten Heeren verlangte. "Am leichtesten", schloß die Studie, "ist die Aufgabe der englischen und amerikanischen Kriegsmarine, sie ist (sic!) aber nicht in der Lage, ihre unbestrittene Seeherrschaft kriegsentscheidend zur Geltung zu bringen." Jodl wußte und räumte ein, daß die Generalstäbe der Westmächte über eigene und sicher bessere Unterlagen verfügten. Dadurch mochten etliche Einzelheiten in einem anderen Licht erscheinen. Was er niederschrieb, kam aus dem Gedächtnis und einer Gefängniszelle. Zudem wünschte er nur zu sehr ein Übereinkommen zwischen den Demokratien und der Sowjetunion, das dem deutschen Volk erlaubte, "dazwischen notdürftig ein kümmerliches Dasein zu fristen". Solch ein Übereinkommen schien ihm sinnvoller als neuer Waffenlärm, doch die strategischen Grundlagen, meinte er, ließen sich "nicht viel anders betrachten".
Auch in Briefen erklärte er, daß er nirgendwo prophezeien wolle. Würde seine Studie gegenstandslos, wäre er selbst am glücklichsten. Hoffnung freilich konnte seinen untergründigen Pessimismus allenfalls dämpfen. Wie vorher glaubte er kaum an ein wirkliches Übereinkommen zwischen den "Todfeinden", noch weniger an die Bereitschaft der Westmächte zu äußerster Kraftanstrengung. Deutschland, so das innerlich unwiderrufene Resümee, war nicht zu halten. Eher als Verteidigungswillen sah er Amerikas Abkehr von einem ewigen Zankapfel-Kontinent und die Herrschaft Rußlands über Europa, den Frieden eines Friedhofes. "Wenn dann das letzte Schiff mit amerikanischen und englischen Truppen die französische Küste verlassen hat, dann wird vielleicht noch einmal die Erinnerung wach werden an den Zweck dieses zweiten Weltkrieges, Deutschland und den Nationalsozialismus als Störer des Weltfriedens zu beseitigen und Polen zu schützen." Aber auch im Frieden eines Friedhofes, meditierte er, "blühen Blumen und singen die Vögel, und solange es noch Friedhöfe gibt, geht auch das Leben weiter seinen Gang".
Möglich, daß Jodls Studie Adressen vorlag, an die er vor allem dachte, ungewiß jedoch, ob sie bei ihnen überhaupt Aufmerksamkeit erweckte. Ihren Gang weiter gingen die Gefängnistage, die sich gerade jetzt - zwischen dem Schlußwort und Urteilsspruch - quälend dehnten. Auch in dieser Phase beim Häftling lediglich angedeutete Gemütsbewegungen, sonst Gelassenheit oder stoische Selbstdisziplin. Das Urteil vom 1. Oktober 1946 - Tod durch den Strang - traf vor allem sein Ehrgefühl. Nur um seiner Frau willen ließ er sich zu einem - vergeblichen - Gnadengesuch bewegen. Seine letzten Briefe aus der Zelle sind, in ihrer Gefaßtheit und Sorge um die ihm Nahestehenden, erschütternde menschliche Zeugnisse. Sie zeigen einen tiefempfindenden, sensiblen Mann, der das, was ihn wahrhaft erfüllte, hinter äußerer Kühle verborgen hatte. Zählten nur diese Zeugnisse, müßte man einen ganz anderen Jodl zeichnen als den einer schrecklichen Kriegsgeschichte.
Er war sich bewußt, einem politischen Prozeß erlegen zu sein. Mit der Anklage "Verschwörung gegen den Frieden" wußte er, der am Kriegsbeginn unbeteiligt war, bis zum Ende nichts anzufangen. Der Vorwurf, daß er für die Erschießung gefangener alliierter Fliegeroffiziere verantwortlich sei, wurde fallengelassen. Den Kommissar-Befehl hatte er nach Kräften abgeschwächt, den Kommando-Befehl als Vergeltung feindlicher Übergriffe aufgefaßt. Wenn er beide Befehle weitergab, so auf ausdrücklichen Befehl und im Auftrag Hitlers. Ein Jahr später, nach dem sogenannten Südost-Prozeß, wäre Befehlsnotstand auch bei ihm anerkannt worden. Einer seiner Richter, der Franzose Donnedieu de Fabre, sprach bald von Justizmord. Liddell Hart, der britische Militärhistoriker, erklärte, daß Jodl zu Unrecht gehängt worden sei. Der Nürnberger Prozeß - fragwürdig in vielen Voraussetzungen - offenbarte hier eher Rache als Maß. Dennoch ist auch im Falle Jodls nicht nur von Rache zu sprechen.
Wie nahezu jeden sog ihn der "Weltanschauungs"-Kampf an, mit dem Hitler seinem Krieg den Stempel aufdrückte. Jodl wünschte weder diesen Kampf noch Deutschlands Weltherrschaft, aber ungefestigt, mehr noch: anfällig geriet er in Verstrickung und Schuld. So mutig seine Einsprüche und Versuche, die ärgsten Übel abzudämmen, am Lagetisch und im Ringen um die Genfer Konvention: Handlangerdienste bei völkerrechtswidrigen Befehlen machten ihn zum Komplizen der "infernalischen Größe", wie er zuletzt Hitler nannte. Auch rückblickend hat er das Wort "Größe" nicht widerrufen.
Er glaubte, Vernunft und Tradition verteidigt zu haben, wenn er sich - immer wieder - Hitler entgegenstemmte. Die Logik des Nürnberger Gerichts, das Verbrechen der Alliierten nicht kennen wollte, stimmte ihn vollends bitter. Im Krieg sah er einen Akt der Gewalt, der Härten verlangte, ja, rechtfertigte, im Partisanenkampf eine Regelwidrigkeit, die überkommene Normen sprengte.
Was ihm das Tribunal vorhielt, waren dennoch Makel. Wie nahezu jeder, der zum engsten Kreis des Diktators zählte, befleckte er Ritterlichkeit und Ehre. Dieses Verhalten, das unsere Nation und deren Armee schändete, hätte ebenso ein neues souveränes Deutschland moralisch verurteilen müssen. Daß Alfred Jodl mit dem Tod am Strang zu büßen hatte, gilt zu recht als Fehlurteil und verbietet, ihn noch anzuklagen. Sein vielleicht größtes Versagen lag indes jenseits juristischer Kategorien und hieß: Führung gegen Erziehung und Erkenntnis. Es nutzt wenig, darüber zu spekulieren, ob ihn das Kadettenkorps - prägende Instanz seiner Jugend - von vornherein in engste Korsette einschnürte, deformierte. Auffällig ist, daß keiner der führenden Militärs im deutschen Widerstand Kadettenanstalten durchlaufen hatte, während sich umgekehrt jene, die einmal Kadetten gewesen waren, nicht für den Widerstand gewinnen ließen. Schlimmer blieb, daß bei Jodl Wunschdenken über zugängliche Analysen triumphierte oder diese Analysen bis zuletzt verdrängte. Strategie konnte hier ausfallen, wie immer sie wollte: politische Illusionen tilgten jedes entscheidende Aufbegehren, das vom Sachverstand her längst geboten war.
Jodls Gehorsamsbegriff ließ ihn glauben, Opfer der Tragik zu sein, und wer ihn billigte, müßte seine Empfindungen teilen. Was Soldaten leitete und er unbeirrt bejahte, war vergeblich, ja, um nichts erbracht. Ein Führer ohne Schutzethos hatte anerzogenen Gehorsam aufs schändlichste, niederträchtig mißbraucht. Tragik aber kann, wenn überhaupt, nur unentrinnbares Geschick bedeuten; nie zählt sie für die Führungsspitzen, die zu handeln vermögen, handeln sollen und müssen. Das Wort Tragik täuschte, bei ihr, über Abdankung von Verstand und Moral. Mochte sich Jodl auf die operative Führung "zurück"stufen: Er stand an der Spitze, ohne militärische Illusionen, die den zweiten und dritten Rang beschwichtigen konnten. Die wirkliche Tragik Untenstehender war ihm versagt.
Jodl starb reuelos, ohne erkennbare Schuldgefühle. Die Jahrzehnte seit seinem Tod hätten ihn kaum umgestimmt. Pflichten gegenüber der Menschheit, die er für eine bessere Zukunft beschwor, werden weiter mißachtet, mit Füßen getreten. Die Nationen sind heilig, Vehikel blutiger Narreteien geblieben. Ungestraft begehen sie, und zwar in Dutzenden von Kriegen, neue schaudererregende Verbrechen. Niemand wagt es oder besitzt die Macht, ihre Ideologen nochmals vor Tribunale zu ziehen, obschon bereits deren Aggressionen anklagewürdig und abzuurteilen wären. Der Nürnberger Prozeß 1945/ 46, rechtlich problematisch, aber auch moralisches Wendezeichen, wurde zum nachträglich verhöhnten einmaligen Exempel. Eitel die Vorstellung, daß Herrschende dem politischen General gestatteten, ihnen in den Arm zu fallen: Kondottiere-Rolle, zu der sich Jodl zuletzt geradezu aufbegehrend bekannte. Die Armee soll - strikter denn je - der Staatsführung dienen. Anderer Ehrgeiz gilt als Militarismus.
Doch so ehern derartige Grundsätze, Konsequenz aus der Heeresgeschichte des Reiches, so eindeutig die Maximen für den Soldaten in Spitzenstellungen. Fiele er ab von Vernunft und Mitverantwortlichkeit, mehr noch: schreckte er zurück vor notwendigem Ungehorsam, würde wieder unser aller Urteil gesprochen. Hier zählt kein Umbruch, keine revolutionäre Waffentechnik. Ethos bleibt allein ohne Abstrich Ethos. Möglich, daß dieses Ethos zur Vergangenheit gehört, versunken in ferne Epochen und Episoden. Was heute droht, sind Selbstmord-Kriege, Kriege mit unlösbaren, ja, von vornherein verhängten Führungskonflikten. Dann wäre, radikal gedacht, die soldatische Existenz vollends unannehmbar, gälten erst recht Pflichten gegenüber der Menschheit. Geschichtsschreibung kann - angesichts solcher Probleme - nur Andeutungen geben; ihr Feld umgrenzt das Gewesene. Aber wie auch immer: Noch ist sie imstande, unseren Blick zu schärfen. Gerade der Gegenwart böte Jodl allemal Lehren.

Generaloberst Jodl bei der Kapitulation
LITERATURHINWEISE
1. Jodl, Luise: Jenseits des Endes. Leben und Sterben des Generaloberst Alfred Jodl. Wien/München/Zürich 1976
2. Loßberg, Bernhard v.: Im Wehrmachtführungsstab. Hamburg 1949.
3. Kriegstagebuch des OKW (1-6) 1940-1945. Frankfurt am Main 1963 ff.
Dr. Bodo Scheurig, geboren 1928 in Berlin, Studium der Neueren Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und der Columbia University New York. Von seinen zahlreichen Publikationen seien auswahlweise genannt: "Freies Deutschland - Das Nationalkomitee und der Bund Deutscher Offiziere in der Sowjetunion 1943 -1945" (1960, 1984 Neuausgabe); "Um West und Ost - Zeitgeschichtliche Betrachtungen" (1969).
Quelle: DAMALS - Das Geschichtsmagazin
Heft 10/Oktober 1986

Alfred Jodl - Hitlers militärischer Berater
Von Bodo Scheurig
Alfred Jodl - Generaloberst, Chef des Wehrmachtführungsstabes und 1946 in Nürnberg durch den Strang hingerichtet - verkörpert den Jammer oder die Tragödie des absoluten Gehorsams. Ursprünglich Opponent Hitlers und ein herausragender Generalstabsoffizier des Reichsheeres, verstrickten ihn später Amt und eine Gläubigkeit, die sich auch gegen klare militärische Erkenntnisse behauptete. Wenn er trotzdem - und zwar als einziger in Hitlers unmittelbarer Umgebung - einer Auseinandersetzung wert bleibt, so vor allem deshalb, weil er dem Diktator auch schroff, mit hochfahrender Schärfe widersprach und die Aufkündigung der Genfer Konvention zu verhindern wußte. Sein Charakterbild - geprägt durch tiefgreifende, unauflösbare Widersprüche - stellt namentlich den Historiker vor Rätsel.
Jodl war als Chef des Wehrmachtführungsstabes ersetzbar, vor allem durch vollkommen Unterwürfige, aber Hitler verweigerte seine vorgesehene Ablösung, nachdem der präsumtive Nachfolger Paulus in Stalingrad geblieben war. Hitler hielt Jodl, auch wenn er diesem Berater hartnäckig grollte, während der Kaukasus-Krise 1942 nicht zu ihm gehalten zu haben. Selbst Eisigkeit im Umgang schien dem Diktator willkommener, als neue, unbekannte Gesichter an seinen Kartentisch zu ziehen. Und instinktiv ging er, von sich aus, wohl die richtigen Wege. So kühl und gespannt seit der Kaukasus-Krise 1942 die meisten seiner Lagebesprechungen waren, die gewohnte Riege ertrug jede Schroffheit, alle Stiche. Trotz anhaltenden Grolls durfte er glauben, daß ihre Loyalität ungebrochen war. Von Torturen seiner Umgebung erfuhr er nichts. Einsprüche veranlaßten ihn, wenn überhaupt, nur zu belanglosen Abstrichen. Wie zuvor entschied und befahl sein Wille.
Jodl fügte sich, drang auf keine Ablösung; vorab aus mangelndem Antrieb, der seine Loyalität bezeugte. Der Preis war bitter, vielleicht auch Anlaß zu trüben Gedanken: das Kommando über eine Gebirgsjäger-Armee - Wunsch nicht nur des Herzens - blieb ihm verwehrt. Um so mehr vergrub er sich in die "Operative Führung", emsig bemüht, diesen Bereich gegen "fremde" Sachverhalte abzuschotten. Weniger denn je wollte er sein Arbeitsfeld ausweiten, sondern lediglich das militärische Tagewerk tun. Bewußt mied er, was "unnötig" verstörte. Fast schien es, als sähe er jenseits seiner gewiß randvollen Pflichten weg. Politik - Korrelat gerade der operativen Kriegführung - schob er von sich. Sie, meinte er, überschaute er nicht, war nie sein Feld. Mochte ihm Schärfe des Verstandes zeitweise sagen, daß er, in zu engen Fesseln, Selbsttäuschungen hegte: Politik sollte und würde Hoffnungen lassen. Schon aus Schutzgründen vertraute er dem Staatslenker Hitler, dessen höherer Einsicht oder besserem Wissen.
Es schien ihm unangemessen, Bedenken oder gar Kleinmut zu zeigen. Ein fester gläubiger Durchhaltewille stand für ihn über allem. Möglich, daß er die Ursachen des Zusammenbruchs von 1918 auch jetzt noch nicht richtig wertete. Im Willen, intakte Moral zu überschätzen, ja, ihr höchsten Eigenwert zuzumessen, blieb er HitIer allzu nahe. Schwankende Siegeszuversicht in Akten und Vorlagen verleitete ihn zu empörten, einschüchternden Randbemerkungen. Bis zuletzt nannte er Lauheit selbst bei höchsten Rängen behende Defaitismus. Warlimont (General Walter Warlimont, Stellvertretender Chef des Wehrmachtführungsstabes im OKW) hörte - bei einem Anlauf zu kritischer Aussprache - Drohungen mit dem Konzentrationslager.
Jodl wollte gewissenhafte, stets "funktionierende" Zuarbeiter, keine, die in Versuchung kamen, Skepsis hinsichtlich der Kriegslage auch nur anzudeuten. Was zu entscheiden und "ganz oben" zu sagen war, wünschte er selbst zu entscheiden und "ganz oben" zu sagen. Jede mögliche Kompetenz seines Bereiches hatte er Zug um Zug an sich gezogen, ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis oft urteilsfähiger Offiziere zu ihrem Chef gleichsam unterbunden. Der Wehrmachtführungsstab war und sollte Jodls eigenes Hilfsbüro sein, das strikt militärische Tagespflichten erfüllte. Der Stab schien je länger, desto mehr passend auf ihn zugeschnitten.
Die vermutlichen Nachteile seines Unwillens, andere als dienstliche Belange zu erörtern, bekümmerten ihn kaum oder ertrug er wohl in dem Glauben, zusätzlicher Erleuchtungen nicht bedürftig zu sein. Die Masse der Unterlagen auf seinem Schreibtisch, mochte er meinen, gewährte ihm hinreichend Überblick. Die Schlüsse seines Denkens, das nicht aufhörte, gingen niemand etwas an. Unwahrscheinlich, daß selbst rückhaltlose Aussprachen unter vier oder mehr Augen seine äußere Haltung geändert hätten. Er hatte im Hauptquartier nur einen Vertrauten: Walter Scherff, den Beauftragten für die Kriegsgeschichtsschreibung, als ergebener Hitler-Anhänger eher eine fragwürdige Adresse. Zu Scherff sprach er von Sorgen, auch über die schändliche Behandlung der gefangenen Rotarmisten, die sein ursprüngliches Ehrgefühl beleidigte. Sonst blieb es bei selbstverordneter, unüberbrückbarer Distanz. Noch weniger drängte ihn seine Schweigsamkeit zu Ansprachen vor dem Stab und anderen Gremien, am wenigsten zu Reden über die instinktiv gemiedene "Politik". Hatte er freilich zu sprechen, wählte er - nach nüchternen Analysen - martialische Schlußworte, die namentlich Sachkenner bestürzen, ja, zu abfälligen Urteilen verführen mußten. Bedenken oder gar Kleinmut sollten, durften sich nicht in des Führers "Gefolgschaft" regen.
Die Opfer des Krieges schmerzten ihn, er verstand Trauer und wußte einfühlend zu trösten, aber gerade im Familienkreis beharrte er bei Klagen auf Unbeugsamkeit, auch wenn er wie sonst den Verstand kaum zu überzeugen vermochte. Als ihn - etliche Monate nach Stalingrad - Luise von Benda fragte, ob nicht der Krieg zu beenden sei, um die Substanz des Reiches zu erhalten, wies er sie "fast mit Schärfe zurecht". Noch in einem Brief sprach er von der Notwendigkeit, durch dick und dünn zu verfechten, daß "wir diesen Krieg gewinnen". "Helden gibt es nur wenige, nur sie kämpfen bis zum Tode. . . Die Masse kämpft nur, solange sie an die Möglichkeit eines Erfolges glaubt. Sieht sie ihn nicht mehr, sucht sich jeder einen bequemen Ausweg, mit dem er dann seinen niedergebrochenen Willen oder seine Feigheit bemäntelt. Wer glaubt, daß man jetzt Frieden machen muß, der erfindet die Ausrede von der Erhaltung der Substanz und will damit nicht sehen, daß er überhaupt alles der Vernichtung preisgibt." Erst während des Nürnberger Prozesses schrieb er, daß diese Kontroverse nur deshalb aufgekommen sei, weil sie in ihm eine schon "wunde Stelle berührt" habe, "die niemand merken durfte". "Sorge um den Kriegsausgang" verbarg er, Mitte 1943, sogar gegenüber seiner Frau; ihren "Idealismus" wollte er zuallerletzt "zerstören".
Seine Fama im Heer war gefärbt durch die Reizworte "Oberkommando der Wehrmacht", in dem man - oft genug - eine frontfremde Befehlsorganisation erblickte und zu der er offensichtlich unablösbar gehörte. Er schien geschätzt bei Rommel, Model, Kesselring und Raeder. Niemand erlag der Versuchung, ihn mit Keitel gleichzusetzen. Selbst kritisch denkende Frontstäbe nannten ihn "operativ begabt, einen soliden Könner", aber zugleich und ebenso häufig "hitlerhörig", ja, "hitlerverfallen". Mehr als nur einmal erweckte er selbst solche Eindrücke.
1942, in der "Wolfsschanze", beantragte der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Generalfeldmarschall von Küchler, die Räumung des Demjansker Frontbalkons, um endlich wieder Reserven für seine Heeresgruppe zu gewinnen. Generalleutnant von Seydlitz-Kurzbach unterstützte ihn, indem er aus eigener Kenntnis die Geländeschwierigkeiten verdeutlichte, die weitere Angriffe zwischen Rshew und Ostaschkow insbesondere mit Panzern unmöglich machten, allein Hitler war - trotz mahnender Frontaufnahmen - nicht zu belehren. Beim Verlassen des Bunkers sagte Jodl zu Seydlitz: "Nach dem, was Sie soeben vorgetragen haben, kann ich Ihnen nur recht geben." Seydlitz erwiderte: "Wie ist es dann aber möglich, daß Sie dem Führer nichts gesagt haben?" Der Chef des Wehrmachtführungsstabes schwieg.
1943, bei einem Besuch in Roccosecca, auf dem Gefechtsstand des XIV. Panzer-Korps an der Nettuno-Front, bat ihn General von Senger und Etterlin, dringliche Ausweichbewegungen zu genehmigen. Wieder ging es, hier unter übermächtigem Feinddruck, um "Aussparung fehlender Reserven": für den Korpsstab eine Notwendigkeit, die "kaum noch zu erörtern" war, zumal die neue Stellung weite Geländeüberblicke bot. Jodl äußerte zu von Senger und Etterlin: "Herr General, Sie haben vollkommen recht, aber der Führer hat es anders befohlen." Derartige Vorfälle hoben schwerlich sein Ansehen, sondern schürten eher Groll, ja, Verachtung. Jeden, auch nur einen Verstoß gegen bessere Einsicht hatte die Truppe mit Blut zu bezahlen.
Um so erwähnenswerter das Urteil des Oberkommandierenden der Lappland-Armee, Eduard Dietl. Nach einem Auffrischungskursus der Universität Königsberg für Offiziere sprach er ungewöhnlich bissig von erlebter Feigheit unter Hochschullehrern. Einer der Professoren - ins Privatquartier Rovaniemi eingeladen - konterte freimütig, daß zur Zeit die Feigheit unter Offizieren weit auffälliger und vor allem viel gefährlicher sei. Er meine, ergänzte der Gelehrte, nicht Feigheit vor dem Feind. "Keine Rede. Aber Feigheit vor dem Führer. Privatim hört man von den Generälen, daß sie militärische Befehle des Führers für hellen Wahnsinn halten. Aber welcher General steht dazu und sagt dies dem Führer, offen heraus, in persona, dienstlich - statt nur hinter seinem Rücken?" Darauf Dietl, ohne Feindseligkeit, beinahe beschwörend: "Sie kennen wahrscheinlich den Führer nicht. Sie können nicht wissen, wie wahnsinnig schwierig es ist, ihm zu widersprechen, mit Erfolg ihm Widerstand zu leisten. Das könnten Sie von unserem Jodl erfahren. Es gibt zwei Jodl, den sogenannten großen und den sogenannten kleinen Jodl. Der kleine Jodl sitzt bei mir, der sogenannte große Jodl sitzt beim Führer. Ich kann Ihnen nur sagen: mein Jodl weiß, daß sein Bruder kein Feigling ist. Wie Sie es eben gemeint haben: der ist tapfer, Tag für Tag, aber ich sag Ihnen: es ist ein Martyrium. 'Sagt's ihm!' Das ist leicht gesagt. Es handelt sich um mehr als Tapferkeit. Stemmkraft, Klugheit, kann ich Ihnen sagen, unausgesetzte, unerhörte Stemmkraft."
Mehr denn je hatte 1945 der Siebenjährige Krieg - erinnern wir uns - als anspornende Parallele herzuhalten. Wie die NS-Propaganda redete Deutschlands Führer davon, daß Friedrich den Großen selbst Aussichtslosigkeit nicht entmutigt hatte, und wie der König mobilisierte er Willenskräfte, deren Fanatismus menschliche Gefühle verleugnete. Durfte man 1762 - konnte sicher auch Hitler fragen - noch für Preußen hoffen? Unbeugsamkeit verriet eher Herostratentum als aristokratisches Ethos. Doch diesmal half kein Tod einer Zarin, sondern war eine übermächtige Feindkoalition ohne Halbheiten zusammengeschmiedet. Diesmal zählten Arsenale und das Ziel der Gegner, einen Aggressor niederzuwerfen und schließlich auszutilgen. Der Fanatismus des Diktators, Rest einer eingebildeten "Mission", zielte ganz ins Leere.
Jodl neigte für sich nicht zu Verstiegenheiten, aber Produkt des Hauptquartiers, verfiel er - bewundernd - weiterhin Hitlers Willenskraft. Die Felonie seines Obersten Befehlshabers erschloß sich ihm selbst in der Endphase nicht. Plagten ihn je Zweifel, versperrte er sie rigoros: Im Diktator sah er Deutschlands legitimen Herrn, Deutschlands Schicksal. Seine nüchterne militärische Einsicht sagte ihm, daß operativ nichts mehr zu bestellen, geschweige denn zu wenden war. Eine Führung, die hätte führen können, hatte ausgespielt. Doch so bitter, ja, quälend diese Einsicht, kein Rückschlag tilgte gerade in ihm, was seit langem Strategien aufzuwiegen hatte: politische Wundergläubigkeit. Sie wurde wie zuvor zur Rechtfertigung, zur Sinngebung auch des vollends Sinnlosen.
Noch immer erhoffte er den Zerfall des feindlichen Bündnisses. Bei jedem Anzeichen, das auch nur eine Entzweiung andeutete, horchte er auf. Teilnehmer der Lagebesprechungen registrierten, wie sich hier seine sonstige "Maskenhaftigkeit" belebte. Dieser Hoffnungsfaden reichte bis zum Zusammentreffen der Gegner im Herzen Deutschlands, für ihn der Zeitpunkt, zu dem die widernatürliche alliierte Kriegskoalition spätestens zerbrechen mußte.
Jodls und anderer Hoffnung schürte namentlich Hitler, doch der Diktator selbst teilte sie schon vor der Ardennen-Offensive nicht, und offen hatte er inzwischen Illusionslosigkeit geäußert. Sogar die Nation konnte es dokumentarisch nachlesen. In seinem Aufruf an die Deutsche Wehrmacht vom 1. Januar 1945 hob er hervor, daß der unbarmherzige Kampf "um Sein oder Nichtsein" ginge. "Denn das Ziel der uns gegenüberstehenden jüdisch-internationalen Weltverschwörung ist die Ausrottung unseres Volkes." Heute, so weiter, könne "an der Absicht unserer Gegner niemand mehr zweifeln". Sie würde belegt durch Erklärungen der feindlichen Staatsmänner. Was also war - angesichts der eigenen militärischen Lage - noch zu erwarten, wenn nicht die sichere Katastrophe? Jodl hoffte, was er hoffen wollte: auch im Rückblick ein Faktor, der ihn salvieren könnte, aber die durchschaubare Wirklichkeit stempelte seine Haltung zu schierem Irrationalismus. Er hatte - nicht allein aus Kommuniqués - von der Teheraner und Jalta-Konferenz erfahren, Konferenzen, die eine ergrimmte Entschlossenheit bekundeten. Auf seinem Tisch lag "Eclipse", jener Plan, der Deutschlands Aufteilung in drei Zonen ankündigte und die russische Zonengrenze längs der Elbe verlaufen ließ. Konnte er, als Militär, ernstlich glauben, daß den Alliierten der Sieg zu entwinden sei - nun, da sie auf dem Sprung standen, mit erdrückender Übermacht ins Reich einzufallen? Es blieb kein Strohhalm, nur die Rettung aller noch Lebenden oder die Barbarei des letzten Gotenkampfes, die er - in Nürnberg - als "Unmöglichkeit für ein 80-Millionen-Volk" selbst verurteilte.
Der Gang des Krieges, Geschehen des Vordergrundes, gebar zudem eigene "Sinngebungen": Sie, schien es, brauchte sich Jodl nicht einmal einzureden. Er teilte die tiefe Furcht vor dem herandrängenden Bolschewismus und wußte: Wie der Frontsoldat wollte die Zivilbevölkerung im Osten nie in die Hände der Sowjets fallen. So unsinnig indes auch hier Hitlers Taktik, die imstande gewesen wäre, Deutschland durch die Westmächte besetzen zu lassen, Taktik, die freilich sein eigenes Ende beschleunigt hätte: Jodl deckte sie bis zu der Starrheit, die in West und Ost jede noch anwendbare Vernunft verhöhnte. Bei einem Erfolg der Ardennen-Offensive, hörte seine zweite Frau Anfang 1945, "hätten wir verhindern können, was sich jetzt in Ostpreußen abspielt".
Derartige Worte nahmen sich angesichts schon zurückliegender Tatsachen - noch gespenstischer aus. Hitler hatte seit langem aufgehört, Adressat eines Friedensschlusses zu sein. Bereits Anfang 1942 (!) äußerte er zu Jodl, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei. Nimmt man ihn beim Wort, hätte er unverzüglich abtreten müssen, um eine politische Lösung freizugeben. Die Wehrmacht konnte, Ziel der Blitzfeldzüge, das Nacheinander ihrer Gegner nicht wiederherstellen; sie stand vor einer ungeschlagenen, nie bezwingbaren Feindkoalition. Das Reich vermochte nur noch zu den besten Bedingungen Frieden zu schließen, Bedingungen, mit denen - so oder so - Hitlers Eroberungen ausgelöscht worden wären. Doch der Diktator weigerte sich, klarer Einsicht zu gehorchen und abzutreten. Staatsmännische Vernunft wich missionarischem Glauben, Politik einem Fanatismus, der selbst die Barbarei des letzten Gotenkampfes erzwingen wollte. Was immer zuletzt Hitler glaubte oder glauben machte, blieb durch sein Bekenntnis von 1942 widerlegt, entwertet.
Die Wehrmachtführung vernahm, daß der Krieg zu liquidieren sei, wenn der Kaukasus, das Donezbecken, die rumänischen Ölfelder und Oberschlesien verlorengingen. Sie setzte auf Ermattungsstrategie im Osten und Westen, die freilich ebenso rasch politisches Handeln verlangte. Begriff sie auch nur ihr eigenes Handwerk, mußte sie den baldigen Abbruch des Krieges ertrotzen. Nichts rechtfertigte sonst weitere Blutopfer an den Fronten. Aber der Diktator verhöhnte, bis zum Kampf um die Reichskanzlei, all seine Kriterien: so, als ob er nie von ihnen gesprochen hätte. Seine Verteidigung jeden Meter Bodens - Strategie der entschlossenen Dummheit - tilgte den Rest der Trümpfe, die Deutschland militärisch nicht verspielen durfte. Der Zusammenbruch - Tragödie des Reiches - nahte mit Riesenschritten. Nach Stauffenbergs Attentat blieb unter dem Diktator: dahinsiechendes Operieren, Schwärze, das Nichts.
Mochte die Wehrmachtführung in der Agonie Gründe finden, um weiterhin auszuharren und Pflichten zu tun: Hitler erniedrigte die Spitzengeneralität zu Robotern. Kampf ohne Glück wurde zum Ausweis der Unfähigkeit und Charakterschwäche. Mehr noch als die Zivilisten hatten die Soldaten des Widerstandes Mühe, den totalen Verrat gültiger Maximen und Ordnungen vorauszusetzen. Was Erziehung, Denk- und Entschlußkraft geboten, mußte um der Nation willen geschehen. Wenn nach 1945 entsetzt, ja, fassungslos auch die Wehrmachtführung gegeißelt wurde, so ist solchen Anwürfen mehr denn je recht zu geben.
Der Bruch erprobter Gesetze raubte dem Frontsoldaten Sicherheit und Geborgenheit. Schutzlos war er sinnlosen Befehlen ausgesetzt, die ihn wie sein Wesen zerrieben und auf die er - 1944/45 - mit Kampf bis zum vorletzten Augenblick zu antworten begann. Das Regime, purer Selbstmagie erlegen, wütete ungehemmt. Es hängte und erschoß schon Laue oder Zögernde; Mannschaften richteten schließlich Offiziere. Terror forderte jenen "Heroismus", den auch sieglose Zukunft nicht schreckte. Der Ausgang ließ die Nation verwüstet und ein Volk zurück, das am Soldatentum zweifeln mußte.
Als Hitler am 22. April 1945 den Krieg selbst für verloren hielt, schien endlich die fürchterlichste Sperre gegen jede Vernunft zu fallen. Der Besessene gab freie Hand, das massenmörderische Ringen einzustellen, aber gleich Keitel richtete Jodl den Diktator nochmals auf. Die Szene - oft bezeugt - blieb die schlimmste innerhalb der Geschichte des deutschen Offizierkorps. Viele, die hätten überleben können, waren zu weiteren Opfern bestimmt. Keitel eilte zu Wenck, dem Oberbefehlshaber der 12. Armee, um ihn zum Angriff nach Osten anzutreiben. Gemeinsam mit der Armee General Busses, die sich von der Oder absetzte, sollte er Berlin entsetzen und den Führer befreien. Ähnlich Jodls Auftrag für den Norden. Schroff verlangte er von Generaloberst Heinrici, daß dessen Heeresgruppe Weichsel, statt nach Mecklenburg auszuweichen, mit allen verfügbaren Kräften die Reichshauptstadt anzugreifen habe. Heinrici zweifelte an der Zurechnungsfähigkeit Jodls.
Die Debatten der beiden Generalobersten verstiegen sich bis zur Verletzung jeder Form, für Heinrici das "unerträglichste Ereignis" seiner Offizierslaufbahn. Die Rote Armee - hier wie dort übermächtig und nicht mehr zu bremsen - machte den Streit gegenstandslos.
War es Jodls Ziel, die alliierten Fronten in Deutschland aufeinander zurücken zu lassen und Hunderttausende vor dem Bolschewismus zu retten: keine abwegigere Strategie hätte er verfechten können. Dieses Ziel - noch sinnvoll, wenn von Sinn überhaupt die Rede sein durfte - verlangte den flüssigen Rückzug und mit ihm den rechtzeitigen Abschub der Zivilbevölkerung. Nichts hinderte die Wehrmachtführung, das Gebotene, ohne ideologische Scheuklappen organisiert zu tun. Unsinnige, weil aussichtslose Offensivunternehmen verhöhnten, was noch als einleuchtendes Konzept taugen konnte. Wie die Ardennenoffensive bürgte ein Angriff auf Berlin dafür, daß die alliierten Fronten nicht aufeinander zurückten und die Rote Armee erst recht Deutschland überschwemmte: Einsichten, die bereits damals nüchtern Denkende beherrschten, von den Männern des Widerstandes zuvor ganz zu schweigen. Jodls Haltung könnte - allenfalls - krankhaft gewordene Loyalität gegenüber Hitler erklären, Loyalität gegenüber einem schon erloschenen Diktator, der selbst aufgegeben hatte. Mit Kriterien militärischer Führung ist sie nicht zu messen. Sie half nur, die Katastrophe ins Abnorme zu steigern.
In Reims unterzeichnete er, eine Woche nach Hitlers Selbstmord, die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte. Jetzt mühte er sich, eigene Fehler ungeschehen zu machen, doch Eisenhower gestand - unwillig, ja, gereizt - lediglich einen Aufschub von 48 Stunden zu. Dönitz gab sein Einverständnis, in diese Galgenfrist für die Armeen und Zivilisten im Osten einzuwilligen. Tausende konnten den Sowjets noch entkommen. Der Großadmiral, laut Testament neues Staatsoberhaupt, berief Männer seines Vertrauens, Fachleute ohne allzu verstörende braune Färbung; die Kommandoverhältnisse in Flensburg, der letzten Enklave, wurden gestrafft, konzentriert. Hitlers Nachfolger löschte dessen "divide et impera". Wehrmachtführungsstab und Generalstab hörten auf, gegeneinander zu bestehen: überfälliges und nun gespenstisches Ende einer Jammergeschichte, die auch beste Führungsspitzen elendig gemacht hätte.
Jodl übernahm - nach dem Abtransport Keitels - die Geschäfte des OKW. Lagebesprechungen vermittelten seine Richtlinien oder das, was der Stab denken sollte. Er wünschte, in allem Dönitz "als Obersten Befehlshaber der Wehrmacht und nicht als Staatsoberhaupt herauszustellen". Wichtige Absprachen mit den Alliierten wollte er den "interessierten Stellen zur Kenntnis gebracht" wissen, "um Unstimmigkeiten zu unterbinden". Haltung und Auftritte, so seine strikteste Weisung, hatten sich an der gegebenen Zwangslage zu orientieren, mehr aber noch den soldatischen Ehrenkodex zu bekräftigen: Bei unwürdigen Handlungen der Delegationen Eisenhowers und Montgomerys war sofort zu protestieren. Überzeugt insbesondere von der amerikanischen Ahnungslosigkeit gegenüber deutschen Problemen, forderte er eigene Eingaben und Vorschläge zu den "großen Organisationsfragen", schon damit sich an ihnen die Sieger ihre Zähne ausbissen. "Wir haben bedingungslos kapituliert, da wir den Krieg bis zur letzten Phase und Konsequenz geführt haben, wo uns nichts anderes übrig blieb. Reminiszenzen an 1918 haben zu unterbleiben. Aus eigener Kraft können wir uns nicht helfen, nur mit Hilfe von anderen; d. h. das Schwergewicht unseres Handelns muß auf dem politischen Sektor liegen. Die Rolle Deutschlands als Volk inmitten Europas ist noch nicht ausgespielt. Ohne uns können die Probleme nicht gelöst werden. Dieses ferne Ziel immer im Auge behalten."
Er selbst fühlte sich berufen, alle Aufgaben zu meistern - Reflex offenbar des verschwundenen Drucks, der ihn jahrelang gequält, gegängelt hatte, doch wie seit je erwartete er festen Zusammenhalt, besonders unter seinen Offizieren. Jeden, der sich nicht als anständig und treu erwies, ja, Befehlen auch nur unbewußt zuwiderhandelte, wollte er einem englischen Gefangenenlager übergeben. Und hier folgte am 13. Mai 1945 - jenes fürchterliche Bekenntnis, mit dem er sich gleichsam selbst richtete, das die Tragik nicht der obersten Führung, sondern die des einfachen hingeopferten Mannes widerspiegelte: "Ich habe fünf Jahre geschwiegen und nur gehorcht und nichts für mich beansprucht, sondern nur gearbeitet. Ich bin gehorsamer Soldat gewesen und habe darin meine Ehre erblickt, den Gehorsam, den ich gelobt habe, zu halten. Ich habe in diesen fünf Jahren gearbeitet und geschwiegen, obwohl ich manchmal völlig anderer Meinung war und mir der Unsinn, der befohlen wurde, oft unmöglich erschien." Einwände aus Betroffenheit wurden nicht vernehmbar. Empörung hätte er auch und gerade jetzt hochfahrend zurückgewiesen. Die Stunde sprach für anerzogene Disziplin und nun, da nicht mehr der Diktator schaltete, sogar für Disziplin ohne innere Vorbehalte. Man muß nachlesen, was Jodl unvermittelt entfuhr.
Doch noch während seines letzten Jahres - 1946 - lag hinsichtlich des persönlichen Lebens "alles klar, sauber und folgerichtig" vor Jodl. Daß er auch ohne die Schuldvorwürfe des Nürnberger Gerichtsstatus versagt haben könnte, ließ sein Gehorsams- und Treuebegriff nicht zu. Dafür "kreiselte der Kompaß seiner Gefühle" bei Gedanken über den Mann, an dessen Seite er "lange Jahre ein so dornen- und entsagungsvolles Dasein" führte. Er leugnete nicht, daß sich dessen "Bild, in dem man einmal ein Kunstwerk zu sehen hoffte", nun in "teuflischer Entartung" zeigte, erdrückende Beweise sprachen unwiderleglich und beredt, aber hatte er, als Nur-Militär im Führerhauptquartier, je diesen ganzen Hitler gekannt und erlebt? Noch immer fühlte er sich außerstande zu sagen, was der Diktator wirklich "gedacht, gewollt und gewußt" hatte, allenfalls was er selbst "darüber dachte und vermutete". Gerade jetzt schien ihm, als habe Hitler - offenbar bestrebt, stets zu täuschen - auch seinen "Idealismus" mißbraucht, benützt zu verborgen gehaltenen Zwecken. War der Diktator teuflisch entartet von Anfang an oder erst später, "parallel mit den Geschehnissen", so vielleicht für künftige Historiker, nicht in Jodls eigener Geschichte. "Manchmal", schrieb er jedoch, "falle ich wieder in den Fehler, der Herkunft die Schuld zu geben, um mich dann wieder daran zu erinnern, wieviel Bauernsöhnen die Geschichte den Namen 'der Große' gegeben hat. Das ethische Fundament, das ist das Entscheidende, nicht der Wille und nicht der Geist."
So vernichtend solch ein Werturteil - auch für ihn, da es schon frühere Erkenntnisse widerspiegelte: Nichts vermochte seine Einschätzung der jüngsten Geschichte wesentlich zu ändern. Wie zuvor hielt er daran fest, daß es in Deutschland 1918 "viele und gute Ansätze zu einer ganz anderen Entwicklung" gab. Loyal, durfte er sich sagen, wäre gerade er ihr gefolgt, hätte sie sich überzeugend und segensreich entfalten können. "Zunichte gemacht" hatte sie der Versailler Vertrag, dem er uneingeschränkt die Hauptschuld beimaß. "Wenn das deutsche Volk nach einem fast zehnjährigen auf- und abwogenden Welt- und Meinungskampf zuletzt doch Adolf Hitler als seinen Führer erwählte, so letzten Endes, weil es keinen anderen Ausweg sah, aber doch mit jenem zweifelnden Vorbehalt und jenem instinktiven Urwissen, daß glänzende Meteore meistens ein Zeichen kommenden Unheils sind." Er selbst hatte, als Offizier der Reichswehr, keinen Anteil an dieser Wahl, nur am Gespür für kommendes Unheil, das er zumindest 1933 zeigte. Die Gründe seines inneren Wandels, die ihn zum Bewunderer Hitlers machten, verhehlte und widerrief er nicht, am wenigsten in Niederschriften ohne Blick auf seine Ankläger im Nürnberger Prozeß. Vielleicht bereute er jetzt - angesichts bestürzender Dokumente - manchen Satz im privaten Tagebuch. Überschwenglichkeit und flammende Worte muteten nun verstiegen an. Aber daß er 1939 den Krieg gewollt habe oder gar für ihn verantwortlich sei, empfand er als infamsten Vorwurf, den er zu Recht weiter bestritt.
Im Krieg selbst erblickte er rückschauend eine Folge von Operationen, in die ihn höhere, Hitlers Entschlüsse, hineingezogen hatten. Was vorab zu tun war, diktierte der Zwang heraufbeschworener Lagen - Lagen mit eigener Logik. Er hätte, bei seiner "unglücklichen Liebe zu den Franzosen", gern den Westfeldzug vermieden, möglicherweise sogar den siegreichen, wenn hier nicht "Zwang von Englands Erbitterung und Unbeugsamkeit" ausgegangen wäre, doch kein Schatten trübte seine Überzeugung, daß der Kampf gegen die Sowjetunion sinnvoll gewesen sei. Wann immer Hitlers Aggression verbrecherisch oder nur mutwillig genannt wurde, zog er das "Argument" des bedrohlichen russischen Aufmarsches im Frühjahr 1941 heran, der die deutsche Führung zum Praevenire genötigt habe. Gegen den wahren, fürchterlichen Charakter dieses Krieges sperrte er sich: einsichtslos, eisig. Bolschewismus blieb ihm wesenhafter Feind, Adolf Hitler nicht dessen Ableger, sondern Verteidiger des Abendlandes. Auch noch aus der Gefängniszelle sah er "Deutschlands Kampf - in seiner idealisierten, historischen Linie - genau so an wie einst den Kampf des Prinzen Louis Ferdinand mit seiner Vorhut bei Saalfeld. Er fiel und seine Truppen wurden geschlagen, aber wie damals: die Hauptkämpfe stehen erst bevor, und ob sie ein Jena und Auerstedt werden oder eine Völkerschlacht von Leipzig - für diejenigen nämlich, die humanistische Kultur zu verteidigen haben -, das liegt unwägbar im Schoße der Zukunft begraben".
Abebbende Prozeßarbeit gab ihm die Zeit zu einer längeren strategischen Studie, ihr Titel: "Ein Krieg zwischen den Westmächten und der Sowjetunion." Er schrieb sie nicht, weil er diesen, Deutschland "endgültig zerstörenden" Krieg ersehnte. Er fürchtete ihn als kommendes Duell zwischen zwei Systemen, erbitterten, unversöhnlichen Todfeinden - spätestens für den Augenblick, in dem Moskau Siegeschancen zu sehen glaubte. Er war sich sicher, daß, wenn den Armeen Sowjetrußlands befohlen würde, "den Vormarsch nach Westen zwischen Ostsee und Alpen anzutreten, sie es mit einer dreifachen oder noch größeren Überlegenheit zu Lande tun werden. Mindestens 25 000 hochwertige Panzerkampfwagen und ein fanatischer, siegeszuversichtlicher Kampfwille wird (sic!) die Stoßkraft dieser Überzahl von Divisionen noch beträchtlich erhöhen". Ihnen ist, so seine Überzeugung, durch die Westmächte nichts annähernd Gleichwertiges gegenüberzustellen. Wenn Rußland einstweilen zögere, so allein wegen der erdrückenden angelsächsischen Luft-Vorherrschaft und der amerikanischen Atombombe. Diese Lage freilich werde sich von Jahr zu Jahr - und zwar für alle drei Wehrmachtteile - zugunsten der Sowjetunion ändern. "Rußland wird alle Anstrengungen machen, seine Unterlegenheit zur Luft zu beseitigen. Es wird deutsche Flieger und Ingenieure dazu heranziehen und nicht ruhen und rasten, bis es das Geheimnis der Atombombe gelöst oder sich sonst verschafft hat." Rüstungswettläufe blieben vorgezeichnet.
Jodl rätselte nicht über Rußlands "wahrscheinliche" Kriegsoperationen. Er sah - längs der Demarkationslinie - die Rote Armee mobilisiert in drei Heeresgruppen: ohne Reserven wenigstens fünf Millionen Mann; die Hauptmacht bei der Mittelfront, zunächst zum schnellen Stoß vom Thüringer Wald auf Mainz bestimmt. "In der Tiefe gestaffelt, werden starke Kräfte hinter diesem vordersten Stoßkeil folgen, um dann, nach Norden und Süden eindrehend, den englischen und amerikanischen Divisionen den Rückzug nach dem Rhein zu verlegen. Die Nordfront wird die Nordseehäfen in Besitz nehmen, im übrigen aber mit ihrer Masse über Münster auf das Ruhrgebiet angesetzt werden. Die Südfront hat in Bayern und Württemberg größere Geländeschwierigkeiten und den weitesten Raum zu überwinden. Sie kommt daher in eine starke Rückwärtsstaffelung zur Mittelfront, was aber gerade dazu verhelfen kann, einen zu zäh vor dieser Front kämpfenden Gegner von Norden her im Rücken zu fassen und zu vernichten." Rettung bot für Jodl allenfalls sofortiger Rückzug hinter den Rhein, doch auch dieser Rückzug nur dann, wenn schließlich 130 bis 150 Divisionen das Westufer des Stroms verteidigten. Er warnte Engländer wie Amerikaner vor der Illusion, inmitten Deutschlands eine Entscheidungsschlacht schlagen zu können. Sie ende, lange bevor Luftwaffeneinsätze wirksam würden, "mit der Vernichtung der englischen und amerikanischen Besatzungsdivisionen östlich des Rheins". Die Rote Armee sei durch Landoperationen nicht mehr zu besiegen.
Einzig die angelsächsische Luftwaffe konnte, in seinen Augen, "vielleicht" die Versorgungsstränge und Kräftequellen des Feindes zerstören und so Rußland zwingen, den Kampf aufzugeben. Dazu bedurfte es indes nicht nur aller Fernbomber, die zuletzt gegen Deutschland und Japan eingesetzt waren, sondern ebenso vorgeschobener und insbesondere gut abgedeckter Basen, um die lebenswichtigen Schlüsselpunkte der UdSSR zu erreichen. Hier dachte der Autor an Schweden und die Türkei, für die Demokratien gewiß "das schwerste" politisch-militärische Problem, schon weil es - neben diplomatischer Kunst - höchstmögliche Stärke auch bei den westalliierten Heeren verlangte. "Am leichtesten", schloß die Studie, "ist die Aufgabe der englischen und amerikanischen Kriegsmarine, sie ist (sic!) aber nicht in der Lage, ihre unbestrittene Seeherrschaft kriegsentscheidend zur Geltung zu bringen." Jodl wußte und räumte ein, daß die Generalstäbe der Westmächte über eigene und sicher bessere Unterlagen verfügten. Dadurch mochten etliche Einzelheiten in einem anderen Licht erscheinen. Was er niederschrieb, kam aus dem Gedächtnis und einer Gefängniszelle. Zudem wünschte er nur zu sehr ein Übereinkommen zwischen den Demokratien und der Sowjetunion, das dem deutschen Volk erlaubte, "dazwischen notdürftig ein kümmerliches Dasein zu fristen". Solch ein Übereinkommen schien ihm sinnvoller als neuer Waffenlärm, doch die strategischen Grundlagen, meinte er, ließen sich "nicht viel anders betrachten".
Auch in Briefen erklärte er, daß er nirgendwo prophezeien wolle. Würde seine Studie gegenstandslos, wäre er selbst am glücklichsten. Hoffnung freilich konnte seinen untergründigen Pessimismus allenfalls dämpfen. Wie vorher glaubte er kaum an ein wirkliches Übereinkommen zwischen den "Todfeinden", noch weniger an die Bereitschaft der Westmächte zu äußerster Kraftanstrengung. Deutschland, so das innerlich unwiderrufene Resümee, war nicht zu halten. Eher als Verteidigungswillen sah er Amerikas Abkehr von einem ewigen Zankapfel-Kontinent und die Herrschaft Rußlands über Europa, den Frieden eines Friedhofes. "Wenn dann das letzte Schiff mit amerikanischen und englischen Truppen die französische Küste verlassen hat, dann wird vielleicht noch einmal die Erinnerung wach werden an den Zweck dieses zweiten Weltkrieges, Deutschland und den Nationalsozialismus als Störer des Weltfriedens zu beseitigen und Polen zu schützen." Aber auch im Frieden eines Friedhofes, meditierte er, "blühen Blumen und singen die Vögel, und solange es noch Friedhöfe gibt, geht auch das Leben weiter seinen Gang".
Möglich, daß Jodls Studie Adressen vorlag, an die er vor allem dachte, ungewiß jedoch, ob sie bei ihnen überhaupt Aufmerksamkeit erweckte. Ihren Gang weiter gingen die Gefängnistage, die sich gerade jetzt - zwischen dem Schlußwort und Urteilsspruch - quälend dehnten. Auch in dieser Phase beim Häftling lediglich angedeutete Gemütsbewegungen, sonst Gelassenheit oder stoische Selbstdisziplin. Das Urteil vom 1. Oktober 1946 - Tod durch den Strang - traf vor allem sein Ehrgefühl. Nur um seiner Frau willen ließ er sich zu einem - vergeblichen - Gnadengesuch bewegen. Seine letzten Briefe aus der Zelle sind, in ihrer Gefaßtheit und Sorge um die ihm Nahestehenden, erschütternde menschliche Zeugnisse. Sie zeigen einen tiefempfindenden, sensiblen Mann, der das, was ihn wahrhaft erfüllte, hinter äußerer Kühle verborgen hatte. Zählten nur diese Zeugnisse, müßte man einen ganz anderen Jodl zeichnen als den einer schrecklichen Kriegsgeschichte.
Er war sich bewußt, einem politischen Prozeß erlegen zu sein. Mit der Anklage "Verschwörung gegen den Frieden" wußte er, der am Kriegsbeginn unbeteiligt war, bis zum Ende nichts anzufangen. Der Vorwurf, daß er für die Erschießung gefangener alliierter Fliegeroffiziere verantwortlich sei, wurde fallengelassen. Den Kommissar-Befehl hatte er nach Kräften abgeschwächt, den Kommando-Befehl als Vergeltung feindlicher Übergriffe aufgefaßt. Wenn er beide Befehle weitergab, so auf ausdrücklichen Befehl und im Auftrag Hitlers. Ein Jahr später, nach dem sogenannten Südost-Prozeß, wäre Befehlsnotstand auch bei ihm anerkannt worden. Einer seiner Richter, der Franzose Donnedieu de Fabre, sprach bald von Justizmord. Liddell Hart, der britische Militärhistoriker, erklärte, daß Jodl zu Unrecht gehängt worden sei. Der Nürnberger Prozeß - fragwürdig in vielen Voraussetzungen - offenbarte hier eher Rache als Maß. Dennoch ist auch im Falle Jodls nicht nur von Rache zu sprechen.
Wie nahezu jeden sog ihn der "Weltanschauungs"-Kampf an, mit dem Hitler seinem Krieg den Stempel aufdrückte. Jodl wünschte weder diesen Kampf noch Deutschlands Weltherrschaft, aber ungefestigt, mehr noch: anfällig geriet er in Verstrickung und Schuld. So mutig seine Einsprüche und Versuche, die ärgsten Übel abzudämmen, am Lagetisch und im Ringen um die Genfer Konvention: Handlangerdienste bei völkerrechtswidrigen Befehlen machten ihn zum Komplizen der "infernalischen Größe", wie er zuletzt Hitler nannte. Auch rückblickend hat er das Wort "Größe" nicht widerrufen.
Er glaubte, Vernunft und Tradition verteidigt zu haben, wenn er sich - immer wieder - Hitler entgegenstemmte. Die Logik des Nürnberger Gerichts, das Verbrechen der Alliierten nicht kennen wollte, stimmte ihn vollends bitter. Im Krieg sah er einen Akt der Gewalt, der Härten verlangte, ja, rechtfertigte, im Partisanenkampf eine Regelwidrigkeit, die überkommene Normen sprengte.
Was ihm das Tribunal vorhielt, waren dennoch Makel. Wie nahezu jeder, der zum engsten Kreis des Diktators zählte, befleckte er Ritterlichkeit und Ehre. Dieses Verhalten, das unsere Nation und deren Armee schändete, hätte ebenso ein neues souveränes Deutschland moralisch verurteilen müssen. Daß Alfred Jodl mit dem Tod am Strang zu büßen hatte, gilt zu recht als Fehlurteil und verbietet, ihn noch anzuklagen. Sein vielleicht größtes Versagen lag indes jenseits juristischer Kategorien und hieß: Führung gegen Erziehung und Erkenntnis. Es nutzt wenig, darüber zu spekulieren, ob ihn das Kadettenkorps - prägende Instanz seiner Jugend - von vornherein in engste Korsette einschnürte, deformierte. Auffällig ist, daß keiner der führenden Militärs im deutschen Widerstand Kadettenanstalten durchlaufen hatte, während sich umgekehrt jene, die einmal Kadetten gewesen waren, nicht für den Widerstand gewinnen ließen. Schlimmer blieb, daß bei Jodl Wunschdenken über zugängliche Analysen triumphierte oder diese Analysen bis zuletzt verdrängte. Strategie konnte hier ausfallen, wie immer sie wollte: politische Illusionen tilgten jedes entscheidende Aufbegehren, das vom Sachverstand her längst geboten war.
Jodls Gehorsamsbegriff ließ ihn glauben, Opfer der Tragik zu sein, und wer ihn billigte, müßte seine Empfindungen teilen. Was Soldaten leitete und er unbeirrt bejahte, war vergeblich, ja, um nichts erbracht. Ein Führer ohne Schutzethos hatte anerzogenen Gehorsam aufs schändlichste, niederträchtig mißbraucht. Tragik aber kann, wenn überhaupt, nur unentrinnbares Geschick bedeuten; nie zählt sie für die Führungsspitzen, die zu handeln vermögen, handeln sollen und müssen. Das Wort Tragik täuschte, bei ihr, über Abdankung von Verstand und Moral. Mochte sich Jodl auf die operative Führung "zurück"stufen: Er stand an der Spitze, ohne militärische Illusionen, die den zweiten und dritten Rang beschwichtigen konnten. Die wirkliche Tragik Untenstehender war ihm versagt.
Jodl starb reuelos, ohne erkennbare Schuldgefühle. Die Jahrzehnte seit seinem Tod hätten ihn kaum umgestimmt. Pflichten gegenüber der Menschheit, die er für eine bessere Zukunft beschwor, werden weiter mißachtet, mit Füßen getreten. Die Nationen sind heilig, Vehikel blutiger Narreteien geblieben. Ungestraft begehen sie, und zwar in Dutzenden von Kriegen, neue schaudererregende Verbrechen. Niemand wagt es oder besitzt die Macht, ihre Ideologen nochmals vor Tribunale zu ziehen, obschon bereits deren Aggressionen anklagewürdig und abzuurteilen wären. Der Nürnberger Prozeß 1945/ 46, rechtlich problematisch, aber auch moralisches Wendezeichen, wurde zum nachträglich verhöhnten einmaligen Exempel. Eitel die Vorstellung, daß Herrschende dem politischen General gestatteten, ihnen in den Arm zu fallen: Kondottiere-Rolle, zu der sich Jodl zuletzt geradezu aufbegehrend bekannte. Die Armee soll - strikter denn je - der Staatsführung dienen. Anderer Ehrgeiz gilt als Militarismus.
Doch so ehern derartige Grundsätze, Konsequenz aus der Heeresgeschichte des Reiches, so eindeutig die Maximen für den Soldaten in Spitzenstellungen. Fiele er ab von Vernunft und Mitverantwortlichkeit, mehr noch: schreckte er zurück vor notwendigem Ungehorsam, würde wieder unser aller Urteil gesprochen. Hier zählt kein Umbruch, keine revolutionäre Waffentechnik. Ethos bleibt allein ohne Abstrich Ethos. Möglich, daß dieses Ethos zur Vergangenheit gehört, versunken in ferne Epochen und Episoden. Was heute droht, sind Selbstmord-Kriege, Kriege mit unlösbaren, ja, von vornherein verhängten Führungskonflikten. Dann wäre, radikal gedacht, die soldatische Existenz vollends unannehmbar, gälten erst recht Pflichten gegenüber der Menschheit. Geschichtsschreibung kann - angesichts solcher Probleme - nur Andeutungen geben; ihr Feld umgrenzt das Gewesene. Aber wie auch immer: Noch ist sie imstande, unseren Blick zu schärfen. Gerade der Gegenwart böte Jodl allemal Lehren.

Generaloberst Jodl bei der Kapitulation
LITERATURHINWEISE
1. Jodl, Luise: Jenseits des Endes. Leben und Sterben des Generaloberst Alfred Jodl. Wien/München/Zürich 1976
2. Loßberg, Bernhard v.: Im Wehrmachtführungsstab. Hamburg 1949.
3. Kriegstagebuch des OKW (1-6) 1940-1945. Frankfurt am Main 1963 ff.
Dr. Bodo Scheurig, geboren 1928 in Berlin, Studium der Neueren Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und der Columbia University New York. Von seinen zahlreichen Publikationen seien auswahlweise genannt: "Freies Deutschland - Das Nationalkomitee und der Bund Deutscher Offiziere in der Sowjetunion 1943 -1945" (1960, 1984 Neuausgabe); "Um West und Ost - Zeitgeschichtliche Betrachtungen" (1969).
Quelle: DAMALS - Das Geschichtsmagazin
Heft 10/Oktober 1986
carlos-allesia - 2. Nov, 09:02

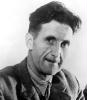
Trackback URL:
https://allesia.twoday.net/stories/1111337/modTrackback